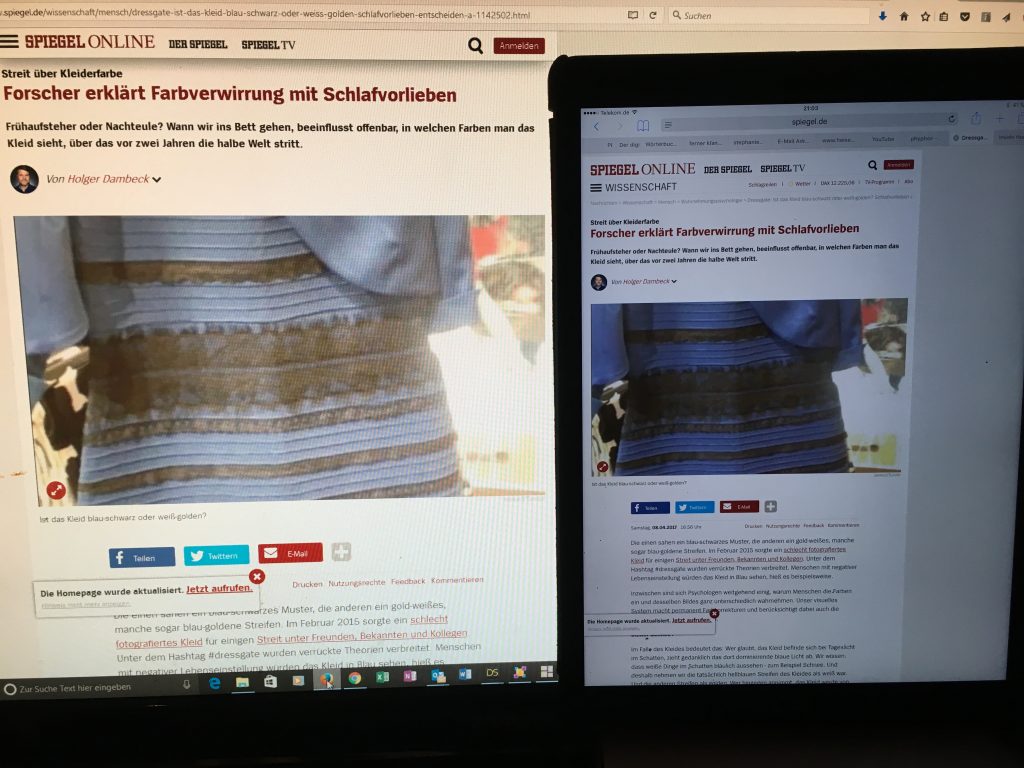In unserer schönen neuen Welt der allseits erwarteten Perfektheit, des ständigen Abgleichs des eigenen Selbst, des eigenen Äußeren oder des eigenen Schaffens mit dem vermeintlich perfekten Selbst oder Äußeren oder Schaffen von anderen, des “Mitbewerbs” also im Leben oder im Beruf; in den Zeiten der ständigen Selbstvergewisserung anhand von “Likes”, Followern oder Abonnenten ist das Aufhübschen der Realität zum völlig normalen Verhalten geworden. Und irgendwie (wobei bei allen Beteiligten das Ausmaß der Einsicht gerne situationsabhängig schwankt…), irgendwie weiß ja jeder: Das ist nicht die Realität, das ist eigentlich gar nicht so glamourös. Das ist eigentlich gar nicht so schön. Das ist gar nicht so eindeutig. Das ist eigentlich gar nicht so spannend.
Es gibt ja bei Instagram oder auf anderen Plattformen etwas, das man “Food Porn” nennt, und der Gedanke hinter dieser semantischen Schöpfung passt natürlich auch auf andere Diszipline; auch “Beauty Porn”, “Fashion Porn”, “(Extreme-) Sport Porn” oder “Travel Porn” (ich erhebe mal sofort Leistungsschutzanspruch auf all diese Neuschöpfungen…) sind also völlig normale, völlig gebräuchliche Realitäts-Aufhübschungen. Und, das jetzt mal meine These aus gegebenem Anlass, es gibt auch “Journalismus- oder Reportage-Porn”.
Claas Relotius’ Reportagen sind unglaublich detailliert ausrecherchiert und eindringlich geschildert und fast schon als Literatur zu bezeichnen. (Aus der Laudatio des Jurors Gero von Boehm bei der Verleihung des Reemtsma Liberty Award 2017)
Eben. Fast schon Literatur. Die Subjektivität ist ja eh eingepreist, ist ja eh konstituierendes Stilmittel bei der “Königsdisziplin” Reportage.
Die Reportage stellt ein spezielles Ereignis oder ein Geschehen so dar, wie es die Autorin/der Autor miterlebt hat und wahrnimmt, um es den Leserinnen und Lesern auch emotional nahezubringen. (Bayerischer Rundfunk: Journalistische Textsorten)
Und natürlich lernt man als junge(r), aufstrebende(r) Journalist(in) auf den entsprechenden Journalistenschulen, bei den Voluntariaten der Zeitungen und Sender, wie das handwerklich gemacht wird.
Generell gibt es keine Standardstruktur oder Musterlösungen für eine gute Reportage, doch lässt sie sich grob in drei Bereiche gliedern: Einstieg, Hauptteil und Ausstieg. Für den Einstieg eignen sich besondere Szenen. Sie sollten den Leser neugierig machen und möglichst Ort, Zeit und handelnde Personen einzuführen. (Journalist-werden.de: Schreibwerkstatt, Teil 3)
So zum Beispiel:
An einem Dienstagmorgen im Januar, vier Tage nachdem Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden ist, steht neben dem Willkommensschild am Ortseingang noch ein zweites Schild, halb so hoch, aber kaum zu übersehen. Jemand muss es in der Dunkelheit aufgestellt haben. Auf diesem Schild, aus dickem Holz in den gefrorenen Boden getrieben, steht in großen, aufgemalten Buchstaben: “Mexicans Keep Out” – Mexikaner, bleibt weg. (Claas Relotius, “Wo sie sonntags für Trump beten“)
Super; nur, dass der Reporter sich das Schild ausgedacht (wieso gab es eigentlich kein Foto davon, und wieso hat die Spiegel-Doku-Abteilung danach eigentlich nicht gefragt oder nachgeforscht?) und noch so ein paar andere Sachen erfunden hat. In den Reportagen von Claas Relotius gibt es offenbar auch als immer wiederkehrendes Stilmittel Musik: Lieder, Songs, die die Protagonisten vielsagend oder rührend selbst anstimmen oder – natürlich, darunter geht’s nicht – in einer Endlosschleife hören. Anscheinend momentan ein regelrechter Fake-Marker bei seinen Stücken. Ansonsten natürlich: Handwerkszeug.
Wenn ich einen Satz sehe wie “draußen beginnen die Hunde zu bellen”, höre ich sofort auf zu lesen. (Ein hellsichtiger Kommentator im SPON-Forum)
Es gibt offenbar auch Leser/Hörer, die unsere journalistischen Handwerks-Stereotype durchschauen; wir Journalisten selbst tun dies natürlich auch – aber in der Rolle als abnehmende Redakteure fordern wir die paradoxerweise, und ohne übermäßige Anforderungen an deren Plausibilität oder Belegbarkeit zu stellen ein. Die Geschichte, das “Storytelling” muss halt natürlich “rund” sein, und anschaulich. Einstieg-Hauptteil-Austieg, der Bogen muss da sein. Oder notfalls zusammengedrechselt werden.
Er steigt mit ihr hinab in den Keller, der nach Schweiß stinkt, über eine Treppe mit 15 Stufen, so steht es da: 15 Stufen, weil Relotius gelernt hat, dass exakte Zahlen die Glaubwürdigkeit des Geschriebenen erhöhen. (SPIEGEL legt Betrugsfall im eigenen Haus offen – Eine Rekonstruktion in eigener Sache von Ullrich Fichtner)
Und, weil der/die abnehmende Redakteur(in) das geil findet und das natürlich genauso wie sein/ihr Autor, womöglich sogar auf der gleichen Journalistenschule gelernt hat; klar, die Zahl der Treppenstufen ist unerlässlich – obwohl eigentlich niemand, kein normaler Mensch in der normalen Situation in Syrien oder sonstwo auch nur im entferntesten auf die Idee kommen würde, die bescheuerten Treppenstufen mitzuzählen. Ist selbstverständlich auch fuckegal, ob das 15 oder 14 oder 16 sind. Bullshit; Reporter-Porn halt.
https://twitter.com/vonWurmbSeibel/status/1075630325198348288
Natürlich ist der Fall – leider – Wasser auf die Mühlen der Fake-News-Apologeten.
Damit die Szenen nicht beliebig wirken, ist es wichtig sich vor dem Schreiben eine These zu überlegen. Diese These ist das Ergebnis der vorherigen Recherche, also die Quintessenz aller Interviews und Beobachtungen, die man im Vorfeld geführt bzeziehungsweise gemacht hat. Anhand dieser These wählt man die Szenen für die Reportage aus. Passt eine Szene nicht zur These, sollte man sie weglassen. (Journalist-werden.de: Schreibwerkstatt, Teil 3 – für die Schreibfehler der Schreibwerkstatt kann ich übrigens nix 🙂 )
Oder eine passende hinzuerfinden 🙂 Ganz ohne Zweifel hat der Spiegel eine These, eine vorgefasste Agenda. Möglicherweise ist das gerechtfertigt, möglicherweise passt die Agenda auch zum angepeilten Zielpublikum; oder möglicherweise ist die Agenda und die Erwartungshaltung an die Autoren in Wirklichkeit aber auch kontraproduktiv und führt zum Mechanismus “geliefert wie bestellt”. “Sagen, was ist.” Nicht, sagen, wie wir gerne hätten, dass es sei. Das gilt natürlich auch für mich und meine Kolleg(inn)en beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Die Erklärungen von Claas Relotius selbst, er habe da unter Erfolgsdruck gehandelt, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Er hat halt in der “Königsklasse” mitspielen wollen und auch bei den entsprechenden gutdotierten Preisen, die systemimmanent “Porn-verdächtig” sind (ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn man jetzt alle preisgekrönten Reportagen der letzten Jahre auf die wirklich minutiös nachprüfbaren Fakten bis zum “ihre zusammengepressten Knöchel werden weiß” nachprüft…). Die Verlockung und das Problem sind systemimmanent, und ich sehe es genauso wie die “Salonkolumnisten” – selbst die an sich lobenswerte Aufarbeitung des Falls beim Spiegel bedient sich wiederum der Stilmittel, die den Fall erst miterzeugt haben.
Und mal an Claas Relotius selbst gerichtet – ich kenne Sie nicht, aber laut allen Einschätzungen ihrer Kollegen sollen Sie ein äußerst angenehmer, bescheiden auftretender, sympathischer Zeitgenosse sein. Tun Sie sich nichts an, verzweifeln Sie nicht; auch wenn Ihre Karriere als Journalist mit der Angelegenheit höchstwahrscheinlich beendet sein sollte. Holen Sie sich Hilfe – und dann wechseln Sie; vielleicht ja zunächst unter Pseudonym, ins literarische Fach. Denn Sie schreiben ja einfach richtig gut, nur bislang im falschen Genre.