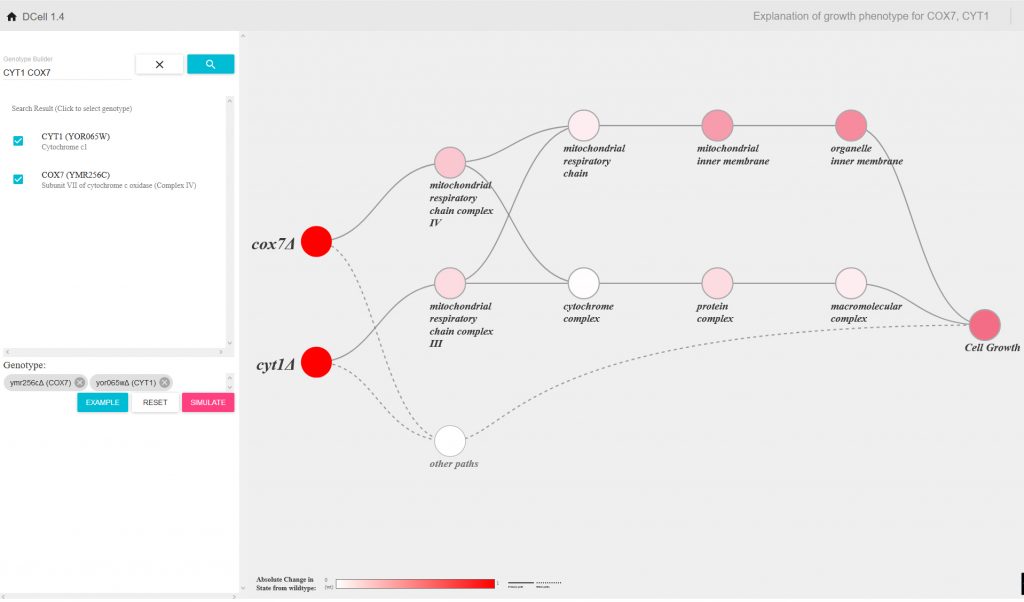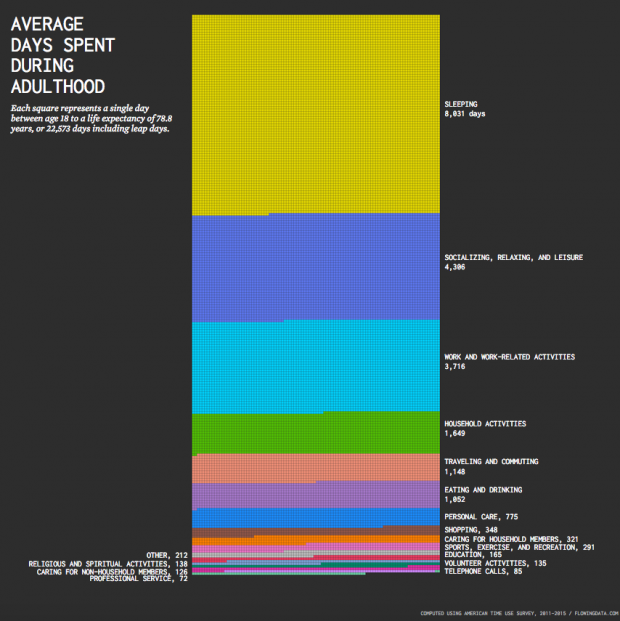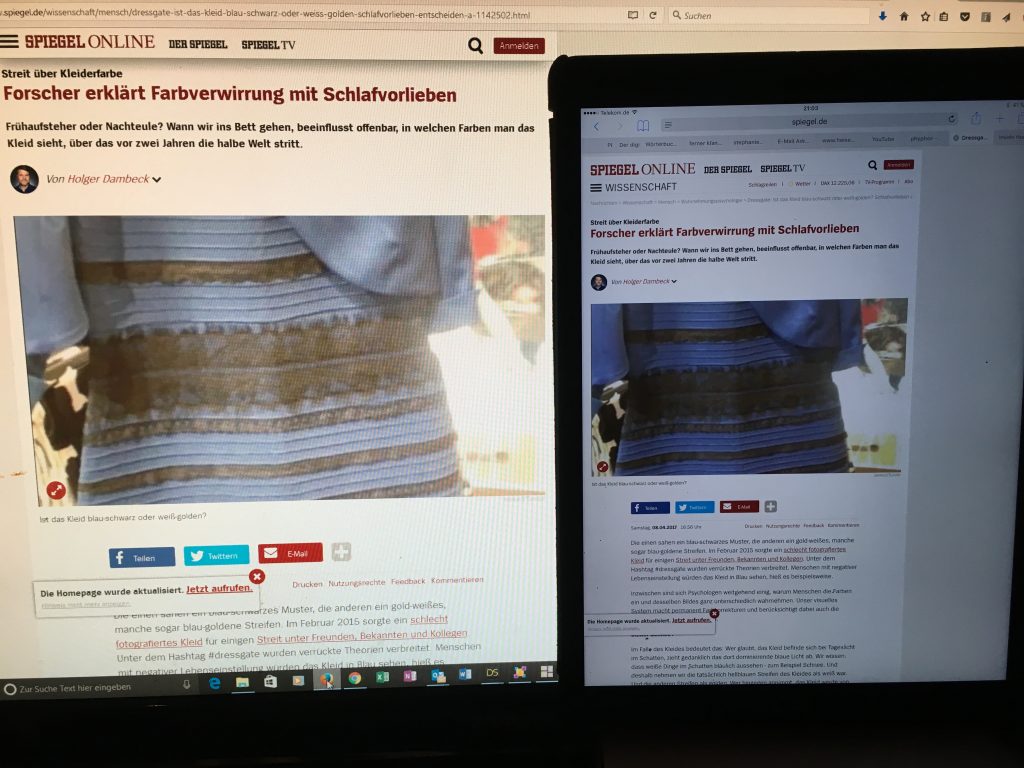Irgendwie denkt man ja: so mitten in der Stadt, oder sagen wir mal am südlichen Rand der Stadt – da hat man mit irgendwelchen Auswirkungen oder Wundern der Natur nicht so wahnsinnig viel zu tun. Stimmt aber gar nicht. Wir haben jetzt ja gerade seit ein, zwei Wochen wirklich stabil schönes Wetter und hohe Temperaturen. Das macht sich in meiner Dachgeschoss-Wohnung deutlich bemerkbar. (Gottlob kümmert sich ja jetzt unser Bundesgesundheitsminister auch um das Problem.)
Mein Lösungsansatz in langen Jahren: Relativ locker oder gar nicht bekleidet hier rumsitzen im Arbeitszimmer. Und zweitens: Die Fenster aufmachen. Auflassen. Durchzug erzeugen, unterstützt von einem Ventilator. Das permanent offene Fenster führt nun allerdings zu einer zunächst unverhofften; inzwischen regelmäßigen Begegnung mit der Natur. Ganz am Anfang, vor Jahren, hab das überhaupt nicht gerafft.
Da kam in gewissen Abständen so ein sirrendes Geräusch irgendwo aus meinem Bücherregal, wie ein durchbrennendes elektronisches Bauteil. Ganz genau zu orten war das nicht. Aber dann nach näherem Hinhören doch nicht mechanisch, sondern eher organisch – ein Insekt. Und dazu passte dann auch, dass da eine Wespe immer in mein Zimmer reinflog und wieder rausflog. Was erstmal nicht so spektakulär war – am Dach vor meinem Fenster war/ist eh ein Wespennest. Manchmal tauchen auch Hornissen auf, die ja bekanntlich wiederum die Wespen fressen.
Aber die in meinem Zimmer war keine gewöhnliche Wespe, sondern irgendwie so ein sehr schlankes, irgendwie auch eher fliegenhaftes Exemplar. Die flog offenbar immer wieder zu dieser erst mal gar nicht identifizierten Stelle im Bücherregal, und dann wieder zum Fenster hinaus. Und wenn das mal zu war, versuchte sie eifrig und immer wieder eifrig von außen reinzukommen. Oder wenn sie drin war und das Fenster zu, rauszukommen.
Welche genaue Unterart bei mir ihr Unwesen treibt, weiß ich natürlich nicht – sachdienliche Hinweise nehme ich gerne entgegen…
Irgendwann hatte ich dann entdeckt, was die da im Regal getrieben bzw. vielmehr gebaut hatte – ein Gefäß, eine Art Kokon aus Lehm. Ich hatte das damals beim ersten Mal angeschaut und dann geöffnet – und war Zeuge eines Dramas: Da war eine kleine tote Wespe drin – aber auch irgendwelche Spinnen. Offenbar war die arme Wespe von den Spinnen aufgefressen worden. Pustekuchen. ich hab das dann mal gegoogelt und gelernt – das ist genau anders rum. Die Töpferwespe baut einen Brut-Kokon aus Lehm, legt darin ein Ei ab und fängt dann bestimmte kleine Spinnen, lähmt die mit einem Stich und packt die als lebendige Nahrung für die sich entwickelnde Larve in den Ton-Kokon.
Wenn alles glatt läuft, frisst die sich entwickelnde Wespe die gelähmten Spinnen, öffnet im Frühjahr das Ton-Gefäß und fliegt in die Welt hinein. Hat bei mir – aus welchen Gründen auch immer – bislang offenbar eher nicht geklappt. Weil das Fenster zu ist, weil die Biester vielleicht vorher austrocknen – keine Ahnung. Jetzt ist also aber trotzdem wieder eine neue Mutter-Wespe bei mir am Werk. Keine Ahnung, ob die von ihrer Mutter oder auf der Töpfer-Wespen-Schule gelernt hat – flieg mal in das Arbeitszimmer von Michael Gessat rein, und dann irgendwo ins Regal – da ist ein Top-Standort.
Das Biest ist auf jeden Fall sehr hartnäckig und zielstrebig. Wenn mein Fenster mal zu ist, dann schwirrt sie draußen vorwurfsvoll rum und schmeißt sich verständnislos gegen die Scheibe. Bis ich die wieder aufmache. Ich überleg immer – was denkt die eigentlich dabei? Die hat offenbar einen ganz genauen Handlungs- und Orts-Plan, und plötzlich knallt die gegen was durchsichtiges festes? Was wäre eigentlich, wenn ich ihr den Kokon/das Ton-Gefäß wegnehme – baut die dann ungerührt ein neues, oder ist die verzweifelt und traumatisiert?
Das sind keine abstrakten Überlegungen. Schon Aristoteles hat sich ja über Schlupfwespen und ihr in Jahrmillionen entwickeltes und erprobtes Fortpflanzungs-Schema Gedanken gemacht, im Mittelalter und bei Charles Darwin war das sogar – nachvollziehbar – Anlass für Theodizee-Spekulationen. Insofern überlege ich ja auch – soll ich die Wespe promoten und schützen, oder der Einhalt gebieten und damit ihren armen unschuldigen Spinnen-Opfern nutzen? Aber wer weiß, was die wiederum fressen.
Es ist so schwer. Und so unfassbar komplex. Dass so ein kleines Tierchen, das wir gar nicht ernsthaft wahrnehmen, ein so ausgekügeltes Verhaltensmuster einprogrammiert hat und das gegen alle Widrigkeiten umsetzt – dass das wiederum, wie bei den anderen Schlupf- oder parasitären Wespen, so ausgeklügelt oder eben einfach über Jahrmillionen evolutiv optimiert an das Leben und Sterben anderer “Wirts”-Arten angepasst ist – das zeigt doch einfach: ???
Keine Ahnung. Dass das Leben unfassbar komplex und selbst-austarierend funktioniert. Ohne einen Gott übrigens, das ist so meine bescheidene Einschätzung. Vielleicht gibt es auch Szenarien, wo so ein System zusammenbrechen kann. Vielleicht bei einer extern ausgelösten Katastrophe wie einem Asteroiden-Einschlag.. Aber ansonsten ist das sehr stabil. Nicht nach menschlichen Maßstäben, aber nach Maßstäben des Lebens.
Ich lass die Töpferwespe mal weiterbauen.
P.S. Kleider- und Nahrungsmittel-Motten werden aber bei mir trotz aller philosophischen bzw. naturkundlichen Überlegungen gnadenlos gekillt. Und Mücken, falls ich die erwische.