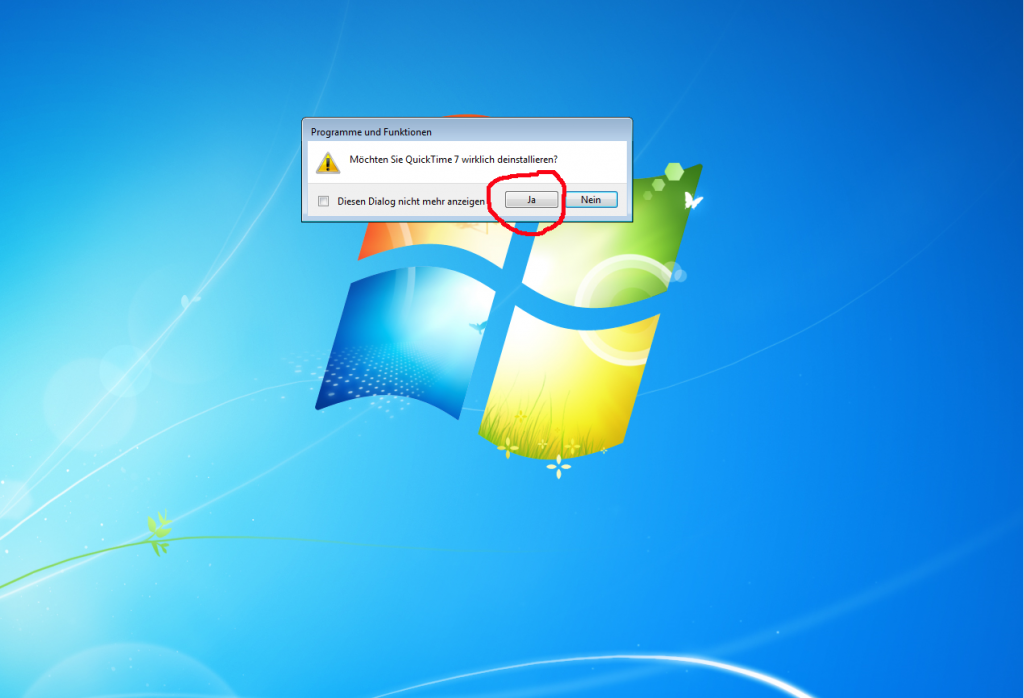Wenn man sich so ganz allgemein anschaut, was Menschen dazu bringt, den sogenannten „Islamischen Staat“ zu unterstützen, dann hat das ja offenbar mit einer rationalen Entscheidung meist nicht allzu viel zu tun. Da sind anscheinend viele geistig unzurechnungsfähige oder psychisch Gestörte dabei, an oder jenseits der Debilitätsgrenze und/oder mit einer Klein- oder Schwerkriminellen-„Karriere“ im Gepäck. Oder eben die „ganz normal“ Orientierungslosen, die von tatsächlicher oder vermeintlicher Chancenlosigkeit Entmutigten – die entweder in islamischen Staaten oder in irgendwelchen westlichen „Gast“- oder „Einwanderungsländern“ ein dankbares Missionierungs-Zielobjekt von fanatischen Anwerbern werden. Und wo man in diesem Spektrum diejenigen hintun soll, die sich von über die Wüste galoppierenden Fantasy-Kämpfern unter der grünen Fahne des Propheten begeistern lassen und auch mal endlich nicht nur am PC, sondern „in echt“ mit Schwertern ungläubige Hälse abhacken wollen, die nach den Jungfrauen im Paradies lechzen und sich auch gern schon einmal auf Erden einen kleinen Vorschuss bei „Sexsklavinnen“ holen – das auch noch mal eine Spezialfrage.
Manch einer erklärt das ganze Phänomen „IS“ ja als Ausdruck einer systemischen sexuellen Neurose – aber so einfach ist die Sache wohl auch nicht. Denn es schließen sich ja auch Frauen dem „Projekt“ an oder unterstützen es – andererseits können natürlich auch Frauen bei einer systemischen sexuellen Neurose mitwirken; sie erziehen schließlich ihre Söhne zu neuen kleinen und später großen Arschlöchern emotionalen Krüppeln. (Zusätzliche traumatische Kindheitserfahrungen ggf. obendrein – geschenkt.) Wie dem auch sei – bei der Kommunikation im Netz, bei der Rekrutierung neuer Kämpfer oder Terroristen kommen anscheinend auch im vermeintlich männerdominierten IS-Universum die klassischen „Soft Skills“ ins Spiel, die Frauen nachgesagt werden. Laut einer Studie in Science Advances haben jedenfalls weibliche Akteure in islamistischen Unterstützergruppen beim russischen Facebook-Pendent VKontakte eine signifikant höhere Verknüpfungseffizienz („betweenness centrality“) als ihre zahlenmäßig stärker vertretenen männlichen „Freunde“.
Und damit bestätigen sich also auch bei einer „extremistischen Gruppe unter Druck“ im zeitgemäßen Cyberraum die netzdynamischen Strukturen aus der alten, analogen Welt – die Studienautoren bringen hier detaillierte Sozialgefüge-Analysen der PIRA (Provisional Irish Republican Army) im Nordirland der 70er und 80er Jahre zum Vergleich. Ob die Welt und die individuelle Kommunikations-, Verfolgungs- und Risikosituation damals nicht doch sehr weit von einer heutigen Social-Media-Aktion am warmen PC entfernt ist, ist eine berechtigte Frage. Aber zumindest die möglichen Konsequenzen laufen ja am Ende auf das gleiche, alte Lied hinaus: Gewalt und Tod im Dienste der höheren Sache; für andere und gegebenenfalls auch für die eifernden Akteure selbst.
Vielleicht liegt ja im besonders engagierten und effektiven weiblichen Netz-Einsatz für den „IS“ letztlich sogar ein emanzipatorisches Element? Aus der Perspektive unter den Kopftüchern mancher Frauen bestimmt. Ob’s stimmt, wird sich ja dann irgendwann nach dem ruhmvollen, unausweichlichen Sieg des Kalifats erweisen. Oder auch nicht.
Social-Media-Aktivitäten des IS: Die Anwerberinnen · DRadio Wissen
DRadio Wissen – Schaum oder Haase vom 13.06.2016 (Moderation: Till Haase)
Islamischer Staat: Frauen geben bei IS-Propaganda im Netz den Ton an – SPIEGEL ONLINE
(Spiegel Online – Netzwelt vom 14.06.2016)